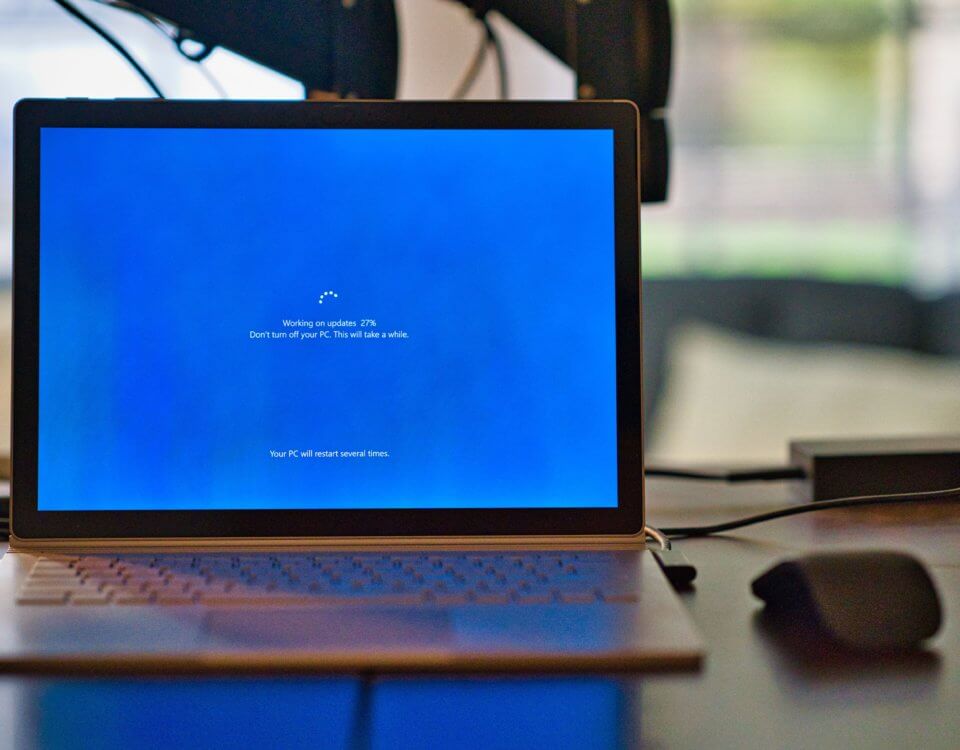Cybersicherheit 2025: Die Bedrohungen nehmen zu

Die Bedrohungslage durch Cyberangriffe ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dabei werden nicht mehr nur Unternehmen und Organisationen, sondern zunehmend auch Privatpersonen Opfer solcher Attacken, die von Hackern oder gar ganzen Hacker-Gruppen über das Internet ausgeführt werden. Die Ziele von Cyberattacken sind äußerst vielfältig und reichen von Datendiebstahl über Identitätsbetrug bis hin zu Erpressung, Spionage oder Angriffen auf kritische Infrastrukturen.
Das Thema Cybersicherheit ist daher wichtiger als je zuvor, und zwar nicht nur für Unternehmen, sondern gesamtgesellschaftlich. Was genau versteht man unter Cybersicherheit, welche Bedrohungen gibt es, und welche Entwicklungen sind in diesem Zusammenhang zukünftig zu erwarten?
Was ist Cybersicherheit und welche Bedrohungen gibt es?
Ganz allgemein versteht man unter Cybersicherheit den Schutz von IT-Systemen, Netzwerken, Geräten und Software vor digitalen Bedrohungen. Diese als Cyberangriffe oder Cyberattacken bezeichneten Bedrohungen umfassen eine ganze Reihe unterschiedlicher Methoden und Techniken, die alle darauf abzielen, unbefugten Zugang auf Computersysteme oder Netzwerke zu erlangen und dort Schäden zu verursachen oder Daten zu stehlen oder zu manipulieren. Zu den häufigsten Cyberbedrohungen 2025 zählen insbesondere:
Ransomware
Ransomware ist spezielle Schadsoftware, die auf ein Endgerät geschleust wird und dort Daten oder Systeme verschlüsselt. Anschließend wird vom Opfer ein Lösegeld verlangt, um die Daten wieder freizugeben.
Phishing und Social Engineering
Bei Phishing und Social Engineering handelt es sich um perfide Täuschungsmethoden, bei denen die Angreifer versuchen, Personen so zu manipulieren, dass sie sensible Informationen wie Zugangsdaten oder Passwörter preisgeben.
DDoS-Angriffe
Als DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) bezeichnet man Angriffe, die darauf abzielen, eine Webseite oder einen Webdienst mit vielen gleichzeitigen Zugriffen von verschiedenen Geräten aus zu überhäufen, sodass die Seite bzw. der Dienst nicht mehr für Nutzer erreichbar ist.
Angriffe auf Lieferketten
Cyberangriffe auf Lieferketten machen sich die Schwachstellen zunutze, die häufig bei niedrigen Gliedern einer Lieferkette, etwa Zulieferern oder Drittanbietern vorzufinden sind. Da diese oft weniger geschützt sind, können sie so Zugriff auf die Systeme und Netzwerke ihres eigentlichen Angriffsziels erhalten.
Bedrohungslage steigt durch KI und zunehmende Vernetzung
Künstliche Intelligenz wird mittlerweile selbstverständlich auch von Cyberkriminellen genutzt, um ihre Methoden zu verbessern und Angriffe zu präzisieren und schwerer erkennbar zu machen. So kann KI beispielsweise täuschend echte Phishing-Mails erstellen, Malware in Echtzeit an Sicherheitsmaßnahmen anpassen oder auch völlig automatisiert Angriffe durchführen. Eine weitere wachsende Gefahr: Die Anzahl der Geräte, die einen Netzwerkzugang haben, ist in den vergangenen Jahrzehnten rasant gestiegen. Während es zunächst nur wenige, hauptsächlich stationäre Computer waren, sind es heute eine Vielzahl an Geräten wie Smartphones, Smartwatches, Tablets, Konsolen, Smart-TVs und Co.
Mehr Geräte im Netz bedeuten automatisch auch mehr potenzielle Ziele bzw. Angriffsflächen für Hacker und Cyberkriminelle, und durch das sogenannte Internet der Dinge (IoT) wird die Anzahl in den kommenden Jahren noch einmal rasant zunehmen. Schon jetzt befinden sich in einem durchschnittlichen Haushalt etwa 5 bis 6 Geräte, die dauerhaft mit einem Netzwerk verbunden sind, von smarten Thermostaten und Beleuchtung, bis hin zu Kühlschränken, die bei Bedarf selbst Lebensmittel bestellen.
EU Cyber Resilience Act soll Cybersicherheit erhöhen
Selbstverständlich versuchen Regierungen mit unterschiedlichen Maßnahmen und Regulierungen, die Cybersicherheit zu erhöhen. Die neueste Verordnung: Seit Oktober dieses Jahres legt der EU Cyber Resilience Act einheitliche Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen fest. Die Verordnung gilt sowohl für Hardware, als auch für Software, welche (direkt oder indirekt) mit einem Netzwerk verbunden sind, sowie Cloud-basierten Lösungen, die als Fernverarbeitungslösungen klassifiziert sind. Sofern Open-Source-Software in kommerziellen Produkten eingesetzt wird, fallen sie auch unter den Cyber Resilience Act.
Ziel der Verordnung ist es, das Cybersicherheitsniveau innerhalb der EU zu verbessern, indem auch solche Produkte reguliert werden, die bislang nicht von den bestehenden Regulierungsrahmen erfasst wurden. Hersteller, Importeure und auch Händler müssen eine ganze Reihe von Vorgaben umsetzen, etwa die Durchführung von Risikoanalysen, die Einhaltung definierter Sicherheitsstandards, die Meldung von Sicherheitsvorfällen oder auch die Zusammenarbeit mit Marktüberwachungsbehörden.
Fazit
Die Cyberbedrohungslage ändert sich stetig und mit jeder neuen Technologie entwickeln Cyberkriminelle immer ausgeklügeltere Methoden, um Schwachstellen zu finden und ihre Attacken durchzuführen. Auch wenn Maßnahmen wie der Cyber Resilience Act die digitale Widerstandsfähigkeit und Cybersicherheit stärken sollen, ist zu erwarten, dass insbesondere die zunehmende Vernetzung digitaler Geräte und der Fortschritt der KI, dafür sorgen werden, dass sich die Bedrohungslage in den kommenden Jahren weiter verschärfen und komplexer wird. Man kann davon ausgehen, dass das Thema Cybersicherheit langfristig relevant bleiben wird.